

Organ
der
GD — Gesellschaft für Dermopharmazie e.V.
| Home |
| Ausgabe: 1/2016 |
| 1/2015 |
| 1/2014 |
| 1/2013 |
| 1/2012 |
| 2/2011 |
| 1/2011 |
| 1/2010 |
| 1/2009 |
| 1/2008 |
| 2/2007 |
| 1/2007 |
| 2/2006 |
| 1/2006 |
| 2/2005 |
| 1/2005 |
| 2/2004 |
| 1/2004 |
| 2/2003 |
| 1/2003 |
| 2/2002 |
| 1/2002 |
| 4/2001 |
| 3/2001 |
| 2/2001 |
| 1/2001 |
| 1/2000 |
| Weitere Links: |
| Gesellschaft für Dermopharmazie |
 |
Ausgabe 2 (2004) |
Dermatotherapie
Leitlinie der GD Gesellschaft für Dermopharmazie e.V. in der Fassung vom 01.04.2003
Dermatologische Rezepturen
Präambel
1 Therapeutisches Konzept
2 Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Schutz vor Irrtümern
3 Qualität der Bestandteile
4 Bedenklichkeit und pharmakologisch-toxikologisch umstrittene Bestandteile
5 Arzneistoff- und Arzneimittelkombinationen
6 Verpackung und Anwendungssicherheit
7 Konservierung und Hygiene
8 Haltbarkeit
9 Vermeidung von Inkompatibilitäten und standardisierte Rezepturen
10 Kennzeichnung und Patienteninformation
11 Unerwünschte Arzneimittelwirkungen
12 Dermatologische und pharmazeutische Aus-, Fort- und Weiterbildung
13 Glossar
14 Verweise
15 Verfahren zur Konsensbildung
Präambel
Dermatologische Rezeptur bedeutet Verordnung, Herstellung und Inverkehrbringen von Topika, die unter der Verantwortung eines Apothekers — in der Regel jeweils bei Bedarf — in einer öffentlichen Apotheke oder Krankenhausapotheke hergestellt werden. Die Rezeptur orientiert sich an den besonderen Gegebenheiten bei einzelnen Patienten. Im engeren Sinne werden als Rezeptur auch die Rezepturformel und das Rezepturarzneimittel bezeichnet. Von dermatologischen Magistralrezepturen wird häufig dann gesprochen, wenn sich Rezepturen durch Erfahrung bewährt haben oder wenn auf rational begründbare Empfehlungen in einschlägigen Veröffentlichungen, insbesondere Sammlungen von entsprechenden Empfehlungen, zurückgegriffen wird. Besondere Bedeutung im Zusammenhang mit der Standardisierung von Rezepturgrundlagen und Rezepturen kommt in Deutschland dem geltenden Arzneibuch — unter Umständen auch früheren Ausgaben einschließlich dem Arzneibuch der DDR — zu sowie dem DAC und dem NRF zu. Soweit auf derartige Vorgaben nicht zurückgegriffen wird, handelt es sich um Individualrezepturen.
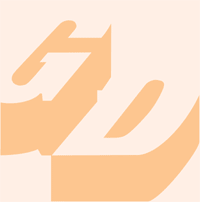
Was pharmazeutische Qualität und Nutzen-Risiko-Bewertung anbetrifft, werden Ärzte und Apotheker ihrer Verantwortung gegenüber den Patienten bei dermatologischen Magistralrezepturen in besonderer Weise gerecht, indem sie sich soweit wie möglich an aktuellen Prinzipien orientieren und diese in die berufliche Praxis umsetzen. Der Nutzen besteht in der Behandlung von Erkrankungen des Hautorgans mit dem Ziel ihrer Beseitigung, das Risiko kann in örtlichen oder systemisch vermittelten unerwünschten Arzneimittelwirkungen beim behandelten Patienten bestehen und/oder einer Belastung der menschlichen Umwelt.
Wesentliche Bedeutung kommt bei der dermatologischen Rezeptur dem Qualitätsmanagement zu. Hierfür tragen die einzelnen Ärzte und Apotheker ebenso Verantwortung wie Kammern, Fachgesellschaften, Berufsverbände und Arzneimittelhersteller, die Komponenten bereitstellen. Die Qualität der dermatologischen Rezeptur ist unter den Aspekten von Struktur-, Prozess- und Ergebnis-Qualität jeweils einzeln sowie gesamthaft zu betrachten. Maßnahmen der internen wie externen Qualitätskontrolle (Ringversuche) sind anzustreben.
Die Leitlinie integriert wichtige Forderungen, die vorrangig aus ärztlicher Sicht bereits 1997 in Form einer Resolution der Kommission „Magistrale Rezepturen“ der DDG formuliert worden sind (siehe Verweise). Sie verbindet darüber hinaus die Belange der dermatologischen Verordnung und Arzneimitteltherapie mit den pharmazeutischen Möglichkeiten und den Grundsätzen der guten pharmazeutischen Praxis im Rahmen der geltenden Rechtsnormen.
1 Therapeutisches Konzept
Magistralrezepturen eröffnen ein breites Spektrum für individuelle Ansätze in der Dermatotherapie. Das vom Arzt gewählte Therapiekonzept definiert die Qualitätsforderung an das Rezepturarzneimittel und muss einschließlich Angaben zur Anwendung für den Apotheker im Wesentlichen aus der Verschreibung erkennbar sein, andernfalls muss es durch Rückfrage beim Arzt bestätigt werden (siehe Punkt 2). Der Apotheker muss dieses Konzept bei Herstellung und Abgabe der Rezeptur unterstützen, insbesondere unter Beachtung der Qualität und der Unbedenklichkeit der Bestandteile bei der betreffenden Anwendungsart, der Verträglichkeit, galenischer Merkmale, der Hygiene, der ausreichenden Konservierung, der Haltbarkeit, der Kennzeichnung, der Applizierbarkeit und der Verpackung. Er soll die Compliance des Patienten fördern. Gegebenenfalls sind Unklarheiten und Bedenken durch Arzt und Apotheker gemeinsam auszuräumen.
2 Interdisziplinäre Zusammenarbeit
und Schutz vor Irrtümern
Zur Vermeidung von Verzögerungen und Fehlern sollen dermatologische Verschreibungen genau und eindeutig ausgestellt werden. Salze beziehungsweise Solvate oder Derivate von Bestandteilen müssen richtig benannt werden, um Fehldosierungen oder Unwirksamkeit zu vermeiden. Bei erkennbaren Irrtümern muss der Apotheker die Unklarheit durch Rücksprache mit dem Arzt vor der Herstellung beseitigen. Auch für den Fall, dass die eigentliche Absicht des Verordners hinreichend sicher erkennbar wird, soll zumindest eine nachträgliche Information zur Vermeidung von Wiederholungen erfolgen.
Rücksprachen sind regelmäßig auch vor der Anfertigung von solchen Magistralrezepturen erforderlich, die umstrittene Arzneistoffe enthalten (siehe Punkt 4), die Bestandteile enthalten, deren Qualität sich nur bedingt sichern lässt (siehe Punkt 3), deren genaue Art der Anwendung unklar ist (siehe Punkte 1 und 10), die auf Grund von Wechselwirkungen der Bestandteile keine oder nur unzureichende Wirksamkeit erwarten lassen oder deren pharmazeutische Qualität ohne Veränderung der Rezepturformel aus verschiedenen Gründen unzureichend wäre (siehe Punkte 7 und 9).
Die Beschränkung auf eine oder wenige Arzneistoffkonzentrationen bei Fertigarzneimittel-Externa ist ein wesentliches Motiv für die Verschreibung von Magistralrezepturen mit individuell abweichenden Konzentrationen. Abweichungen von der Normkonzentration können insofern beabsichtigt sein oder auf einem Irrtum beruhen. Da versehentlich zu hoch konzentrierte Arzneistoffe den Patienten erheblich gefährden können, sind auf Anregung der Kommission Magistralrezepturen der DDG ausgewählte Dermatika-Wirkstoffe mit so genannten oberen therapeutischen Richtkonzentrationen im NRF (Tab. I.6.-1) gelistet. Bei Überschreitung dieser Konzentrationen in rezepturmäßiger Verordnung soll der Arzt seine Absicht durch ein Ausrufungszeichen kenntlich machen. Fehlt ein solcher Vermerk, muss die Apotheke die Unklarheit vor der Herstellung ausräumen.
3 Qualität der Bestandteile
Die arzneimittelrechtlich erforderliche Qualität der Rezepturbestandteile muss vom Apotheker festgestellt und belegt werden. Grundsätzlich dürfen deshalb nur mit einem Prüfzertifikat gemäß §§ 6 und 11 ApBetrO oder mit vollständiger apothekeneigener Qualitätsdokumentation versehene Grundstoffe und Zubereitungen, verkehrsfähige Fertigarzneimittel oder in der Apotheke nach den anerkannten pharmazeutischen Regeln hergestellte Stoffe und Zubereitungen in Rezepturen verschrieben, verarbeitet und in Verkehr gebracht werden.
4 Bedenklichkeit und
pharmakologisch-toxikologisch
umstrittene Bestandteile
Ärzte und Apotheker haben bei der Beurteilung der Bedenklichkeit den aktuellen Erkenntnisstand der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaften zu beachten, wie er unter anderem Stellungnahmen des BfArM beziehungsweise der AMK und der AKdÄ sowie wissenschaftlichen Beiträgen in Fachzeitschriften entnommen werden kann. Die im Rahmen der Nachzulassung von Fertigarzneimitteln durch Aufbereitung wissenschaftlichen Erkenntnismaterials amtlich bekannt gemachten Monographien sind bei der Beurteilung zu beachten. Im Zweifel sollen Informationen eingeholt werden, zum Beispiel bei Einrichtungen der Kammern, bei Fachgesellschaften, Berufsverbänden oder bei den zuständigen Behörden. Bedenkliche Rezepturen dürfen weder verschrieben, hergestellt noch abgegeben werden. Die Bedenklichkeit kann sich unter anderem unmittelbar aus den pharmakologisch-toxikologischen Eigenschaften bestimmter Arzneistoffe beziehungsweise sonstiger Rezepturbestandteile ergeben oder aus dem Zusammenwirken von Bestandteilen oder vor dem Hintergrund der beabsichtigten Dosis, Konzentration, Anwendungsart und Anwendungsdauer.
Eine Nutzen-Risiko-Abschätzung bei pharmakologisch-toxikologisch umstrittenen Bestandteilen beziehungsweise Rezepturen ist vor dem Hintergrund therapeutischer Alternativen vorzunehmen. Bei Negativmonographien oder anderweitig überwiegend negativ beurteilten Bestandteilen (oder Rezepturen) muss die Nutzen-Risiko-Beurteilung jeweils im Einzelfall vorgenommen werden. Vor allem eine ausnahmsweise positive Beurteilung soll schriftlich dokumentiert werden, zum Beispiel mit Hilfe der Vorlage gemäß NRF, Abbildung I.5.-1. Wirtschaftliche Gesichtspunkte dürfen in diesem Zusammenhang keine Rolle spielen.
5 Arzneistoff- und
Arzneimittelkombinationen
Magistralrezepturen sollen unter rational nachvollziehbaren Gesichtspunkten zusammengesetzt sein und Arzneistoffe jeweils in therapeutisch wirksamen Konzentrationen enthalten. Zwei oder mehr arzneilich wirksame Bestandteile sollen nur in begründeten Ausnahmefällen in Externa kombiniert werden.
Mehrfachkombinationen sind nicht nur mit steigender Zahl der Arzneistoffe zunehmend schwerer rational nachzuvollziehen, sondern auch kaum noch in ihrer pharmazeutischen Qualität zu überschauen und zu sichern. Dies gilt insbesondere bei der Verarbeitung von Fertigarzneimitteln in einer Rezeptur (siehe Punkt 9).
Zur Verdünnung eines Fertigarzneimittels soll möglichst die identische Grundlage — zumindest eine Grundlage des gleichen Typs — verwendet werden.
6 Verpackung und
Anwendungssicherheit
Magistralrezepturen müssen so verpackt werden, dass die erforderliche Arzneimittelqualität im vorgesehenen Anwendungszeitraum gewährleistet ist und das Arzneimittel bestimmungsgemäß und sicher angewendet werden kann. Verpackungsempfehlungen der AMK, des NRF und des ZL sollen beachtet werden. Soweit erhältlich, sollen Primärpackmittel mit einer Zertifizierung nach zeitgemäßen spezifischen Normen verwendet werden, zum Beispiel gemäß der Anlage H des DAC oder den ZL-Verpackungsvorschriften.
7 Konservierung und Hygiene
Dermatologische Magistralrezepturen müssen hygienisch einwandfrei hergestellt werden und während des Anwendungszeitraumes auch bleiben. Das bedeutet in bestimmten Fällen Sterilität, in der Regel eine Keimzahlbegrenzung auf nicht mehr als 100 Keime pro Gramm beziehungsweise Milliliter unter Ausschluss bestimmter Leitkeime und Krankheitserreger. Zur Herstellung dürfen deshalb nur hygienisch unbedenkliche Ausgangsstoffe (einschließlich Wasser) und Packmittel verwendet werden und nur anerkannte Arbeitstechniken angewendet werden. Die GD-Hygienerichtlinie und die relevanten Leitlinien zur Qualitätssicherung der Bundesapothekerkammer sind zu beachten. Mikrobiell anfällige Magistralrezepturen sollen grundsätzlich durch Zusatz eines geeigneten Konservierungsmittels vor mikrobiellem Verderb geschützt werden. Wenn die Konservierung ausgeschlossen werden soll, hat der Arzt dies zu vermerken („Nicht konserviert!“).
Enthaltene Konservierungsstoffe müssen gekennzeichnet werden (siehe Punkt 10).
8 Haltbarkeit
Mangelnde Langzeitstabilität kann für das Fehlen von Fertigarzneimitteln mit bestimmten Arzneistoffen oder auf der Basis bestimmter Dermatikagrundlagen verantwortlich sein, und hieraus kann sich ein wesentliches Motiv für die Verschreibung solcher Magistralrezepturen ergeben. Magistralrezepturen brauchen nur für den vorgesehenen Anwendungszeitraum stabil zu sein.
Bei anwendungsfertigen Arzneimitteln sind die Haltbarkeitsfrist und die Aufbrauchsfrist beim Patienten zu unterscheiden. Für ad hoc hergestellte Rezepturen fallen jedoch Verordnung, Herstellung, Abgabe und Anbruch in der Regel zeitlich so eng zusammen, dass hier die Haltbarkeit vor Anbruch neben der Aufbrauchsfrist praktisch nur bei Sterilarzneiformen eine Rolle spielt. Rezepturen sollen bei Abgabe mit einem konkreten Enddatum der Aufbrauchsfrist (siehe NRF, Abschnitt I.4., Allgemeine Hinweise, insbesondere Tabellen I.4.-2 und I.4.-3) gekennzeichnet werden, zum Beispiel: „Nicht mehr anwenden nach dem ...“. In der Apotheke verwendete Arzneimittel-Stammzubereitungen und Dermatika-Grundlagen unterliegen einer anderen Systematik (siehe NRF). Die Verwendung angebrochener Packungen von Fertigarzneimitteln für Rezepturzwecke in Apotheken ist zeitlich sinnvoll zu begrenzen; zum Beispiel können hilfsweise die NRF-Richtwerte für Aufbrauchsfristen ab Anbruch herangezogen werden, ohne dass allerdings das Verfalldatum des Herstellers hierbei überschritten werden darf.
9 Vermeidung von Inkompatibilitäten
und standardisierte Rezepturen
Inkompatibilitäten zwischen Rezepturbestandteilen und zwischen Rezepturen und ihren Primärpackmitteln lassen sich bei der Beschränkung auf Fertigarzneimittel und auf standardisierte Vorschriften, zum Beispiel nach SR oder NRF, vermeiden. Soweit Fertigarzneimittel oder analoge NRF-Rezepturen zur Verfügung stehen, sollen individuell komponierte Rezepturen nur in speziell begründeten Fällen verschrieben werden.
Bei Verarbeitung von Arzneistoffen in einfach zusammengesetzten Dermatika-Grundlagen aus anerkannten und allgemein zugänglichen Vorschriften (zum Beispiel
aus DAB, DAC, SR oder NRF) lassen sich mögliche Inkompatibilitäten weitgehend voraussagen und durch Ausweichen auf Alternativen vermeiden.
Rezepturen auf der Basis von Marken-Grundlagen oder Fertigarzneimitteln sollten nur dann verschrieben werden, wenn seitens des Pharmaherstellers experimentell gesicherte Daten zur physikalischen, chemischen und mikrobiologischen Qualität und Haltbarkeit über einen für die vorgesehene Behandlung angemessenen Zeitraum vorgelegt werden können.
Soweit im gegebenen Zusammenhang möglich, ist grundsätzlich Rezepturen der Vorzug zu geben, die sich in anerkannten und allgemein zugänglichen Vorschriften
finden (zum Beispiel im DAB, DAC, SR, NRF, Standardzulassungen oder ADKA-Vorschriften).
10 Kennzeichnung und
Patienteninformation
Magistralrezepturen sind bei rezepturmäßiger Herstellung von der Apotheke gemäß ApBetrO zu kennzeichnen. In Präzisierung und Ergänzung der dort genannten
Pflichtangaben wird empfohlen, die Kennzeichnung in deutscher Sprache vorzunehmen.
Die Bezeichnung von Arzneistoffen darf nicht so abgekürzt oder so angegeben werden, dass der Patient beziehungsweise der Empfänger über den Inhalt getäuscht wird. Bei Glukokortikoidhaltigen Externa ist „Kortisonhaltig!“ anzugeben.
Arzneilich wirksame Bestandteile sind nach Art und Menge zu deklarieren. Sonstige Bestandteile sind nach den geltenden Bestimmungen zu kennzeichnen. Die Angaben müssen für eine Wiederholung der Rezeptur in identischer Zusammensetzung ausreichend sein.
11 Unerwünschte
Arzneimittelwirkungen
Ärzte und Apotheker sollen Beobachtungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen auch bei Magistralrezepturen dokumentieren und den Arzneimittelkommissionen
melden. Es empfiehlt sich, eine Kopie in der Apotheke beziehungsweise Arztpraxis zu dokumentieren.